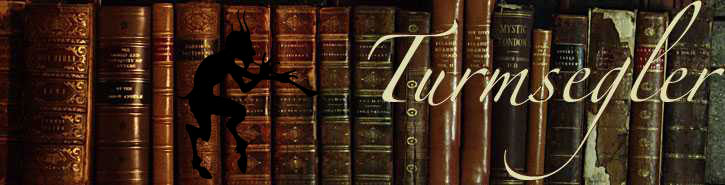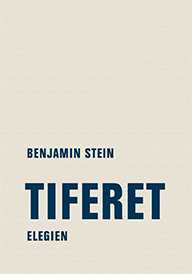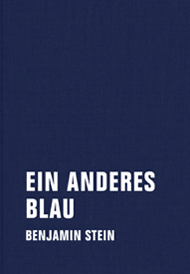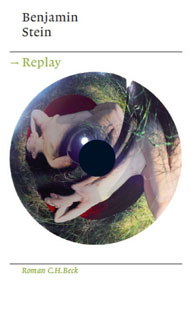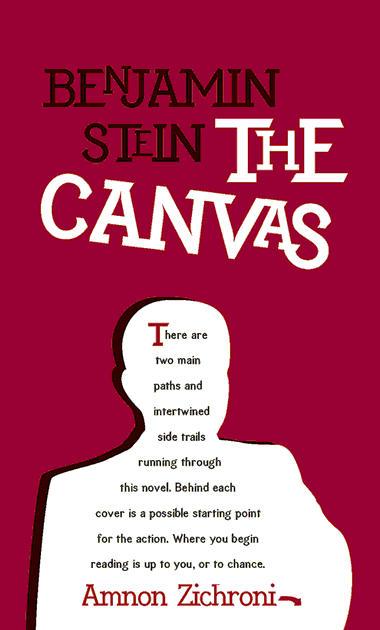23. April 2008
Denkmal der Bücherverbrennung Berlin Bebelplatz • Foto: Daniel Neugebauer
Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.
Heinrich Heine
••• Diesem Heine-Zitat bin ich erst kürzlich wiederbegegnet — in Yad Vashem. Jene Bücherverbrennung ist nun bald 75 Jahre her. Was ich heute bei Szylla lese, war mir tatsächlich neu:
Im Mai 1933, wenige Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, kam es in fast allen größeren Städten Deutschlands zu organisierten und systematisch vorbereiteten Bücherverbrennungen. Sie wurden nicht von der NSDAP oder einem Ministerium organisiert, sondern von der Deutschen Studentenschaft.
Über die lange Tradition von Bücherverbrennungen berichtet ein Wikipedia-Artikel, ein anderer spezifisch über jene Bücherverbrennungen 1933 in Deutschland.
Audio-Dokument: Tonmittschnitt der »Feuersprüche«
Tags: Ausser der Reihe
7 Kommentare »
22. April 2008••• In Bat Yam (Israel) verhaftete die Polizei am Montag Nachmittag einen 27jährigen Yeshiva-Studenten. Er hatte sich in einem Supermarkt entkleidet und trug schließlich nur noch einen Socken als notdürftigen Sichtschutz über seiner Scham. Der Student wollte mit seiner Aktion gegen eine jüngst gefällte Gerichtsentscheidung protestieren, der nach in einigen Geschäften der Verkauf von Chametz zu gestatten sei.
Vor einigen Wochen hatte das Jerusalemer Stadtgericht verfügt, dass das so genannte Matzot-Gesetz, das die Ausstellung von Chametz (Esswaren, die über Pessach für Verzehr und Besitz verboten sind) in öffentlichen Bereichen verbietet, nicht auf Supermärkte, Pizzerien und Restaurants anzuwenden sei, da man sie nicht als „öffentlich“ bezeichnen könne.
Den ganzen Beitrag lesen »
Tags: Ausser der Reihe
0 Kommentare »
18. April 2008
Mario Benedetti und Juan Carlos Onetti
••• Montevideo – dies für jene, die sich unsicher sind – ist die Hauptstadt von Uruguay. Und als wäre eine geheime, Verbindungen stiftende Macht im Spiel, treffe ich gestern und heute gleich mehrfach auf Uruguay und Montevideo, genauer: auf zwei Autoren, die von dort stammen.
Den ganzen Beitrag lesen »
Tags: Juan Carlos Onetti • Juan Gelman • Mario Benedetti • Ausser der Reihe
1 Kommentar »
18. April 2008
Zentauren – © Kerstin S. Klein (2008)
Kein Galopp jetzt mehr. Jetzt ist alles gut.
Jetzt sind wir wie alle anderen. Niemand wundert sich mehr über uns. Vorbei die Zeit, wo man uns als absonderlich bezeichnete — weil wir niemals an den Strand gingen, weil Tita, meine Frau, immer Hosen trug. Absonderlich, wir? Nein. Vergangene Woche kam der Geisterbeschwörer Peri zu Tita, und der ist allerdings ein absonderlicher Mann — ein kleiner, schlanker Indiomischling mit spärlichem Bartwuchs, behängt mit Ketten und Ringen, in der Hand einen Stab und von geheimnisvoller Sprache. Es mag ja ungewöhnlich scheinen, daß ein so seltsames Wesen zu uns kommt; aber schließlich kann jeder an der Tür klingeln. Und außerdem — absonderlich gekleidet war er, nicht wir. Wir? Nein. Wir sind von ganz normalem Aussehen.
© Moacyr Scliar (1980, 1985)
Übertragung: Karin von Schweder-Schreiner
••• Im Urlaub habe ich ein Buch erneut gelesen, das ich noch zu DDR-Zeiten gekauft und zum ersten Mal gelesen haben muss: „Der Zentaur im Garten“ von Moacyr Scliar.
Halb Mensch, halb Pferd, kommt Guedali, Sohn jüdischer Einwanderer in Brasilien, auf die Welt. Seine Geburt stellt die ratlosen Eltern vor durchaus nicht alltägliche Fragen. Womit ernährt man ein mythologisches Fabelwesen? Wie lässt sich an ihm die Beschneidungszeremonie vollziehen? Vertragen sich Tierleib und der zarte Torso des Kindes?
Den ganzen Beitrag lesen »
Tags: Moacyr Scliar • Prosa
0 Kommentare »
17. April 2008
••• Das Schreibheft Nr. 70 – zu dem ich nach der Erstbekanntschaft – natürlich gegriffen habe, hat es mir nicht leicht gemacht. Das zählt ja auch nicht zu den Aufgaben einer Literaturzeitschrift. Aber man ist nicht jeden Tag gleich zugänglich für Experimentelles.
Die von Norbert Hummelt besorgte Neuübersetzung von T. S. Eliots „The Waste Land“ knüpft an das Pound-Thema des vorangegangenen Heftes an, denn Pound hat Eliot durch sein Lektorat nicht unwesentlich dabei geholfen, dieses Opus überhaupt zu vollenden! Hummelt geht in seinen anschließend abgedruckten Notaten zur Übersetzung auch auf die bisher verfügbaren Übertragungen ein.
Schließlich bin ich nach einigem irritierten Blättern auf eine für mich echte Neuentdeckung gestoßen: Ivo Michiels.
Den ganzen Beitrag lesen »
Tags: Ivo Michiels • Literaturzeitschriften • Sigrid Bousset • Prosa
3 Kommentare »