
J. M. Coetzee (Quelle: wikipedia)
»Vielleicht gegen Ende des Winters«, denke ich, »wenn der Hunger richtig zubeißt, wenn wir frieren und Mangel leiden oder wenn der Barbar wirklich vor dem Tor steht, vielleicht werde ich dann die Ausdrucksweise eines Beamten mit literarischen Ambitionen aufgeben und anfangen, die Wahrheit zu erzählen.«
J. M. Coetzee
aus: »Warten auf die Barbaren«
© S. Fischer Verlag (2001)
••• Zwischen den Jahren habe ich in Feinschmeckermanier (langsam und in kleinen Happen) J. M. Coetzee gelesen. Natürlich sollte man diesen Autor längst kennen. Dem Nobelpreis für Literatur, den Coetzee 2003 erhielt, gingen diverse andere hochkarätige Würdigungen seines Werks voraus, u. a. eine zweimalige Auszeichnung mit dem Booker Prize.
»Warten auf die Barbaren« ist keines der Booker-Prize-Bücher, aber ungeachtet dessen ein lohnender Einstieg in Coetzees Werk.
Der Roman spielt großteils in einer Grenzstadt eines zeitlich und örtlich nicht näher bestimmten »Reiches«. Der oberste Vertreter dieses Reiches in der Stadt ist der Magistrat, ein Verwaltungsbeamter, der auch für die Rechtsprechung zuständig ist. Der Magistrat berichtet als Ich-Erzähler seine Erlebnisse, Reflexionen und die Geschehnisse in der Stadt nach Eintreffen eines gewissen Oberst Joll.
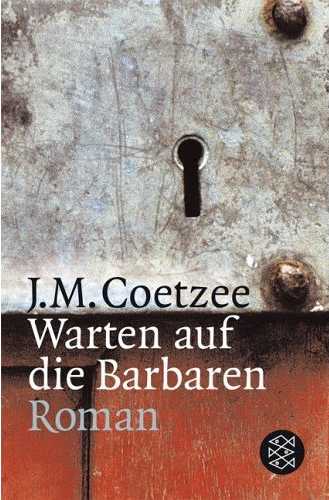 Der Oberst gehört der Abteilung III der Staatspolizei an, die dafür bekannt ist, mit inneren und äußeren Feinden des Reiches angemessen – und das heißt: mit äußerster Härte – vorzugehen. Oberst Joll wurde in die Grenzstadt entsandt, um eine Strafexeption gegen die Barbaren vorzubereiten und anzuführen. Die Barbaren sind Nomaden, die in der Wüste und den Bergen jenseits der Reichsgrenzen umherziehen. Glaubt man den Informationen des Obersten, planen sie einen großangelegten Angriff auf das Reich. Die Strafexpedition soll den Gegner einschüchtern, und man will Gefangene machen, um von ihnen Informationen zu erhalten, die der Verteidigung des Reiches nützlich sein könnten.
Der Oberst gehört der Abteilung III der Staatspolizei an, die dafür bekannt ist, mit inneren und äußeren Feinden des Reiches angemessen – und das heißt: mit äußerster Härte – vorzugehen. Oberst Joll wurde in die Grenzstadt entsandt, um eine Strafexeption gegen die Barbaren vorzubereiten und anzuführen. Die Barbaren sind Nomaden, die in der Wüste und den Bergen jenseits der Reichsgrenzen umherziehen. Glaubt man den Informationen des Obersten, planen sie einen großangelegten Angriff auf das Reich. Die Strafexpedition soll den Gegner einschüchtern, und man will Gefangene machen, um von ihnen Informationen zu erhalten, die der Verteidigung des Reiches nützlich sein könnten.
Oberst Joll beschafft Informationen. Dabei ist er überzeugt, dass jeder Verhörte grundsätzlich lügt und erst durch die Erfahrung von Angst, Schmerz und Demütigung so weit geläutert wird, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. »Warten auf die Barbaren« ist ein Buch über Folter.
Coetzee bettet die Behandlung des Themas in einen zeitlosen Plot. Ort, Personen und Handlung sind Metapher, und der Autor spielt in nüchterner und dennoch sehr atmosphärischer Sprache eine Vielzahl Facetten des Themas durch. Wir begegnen u. a. dem Folterer, dem Gefolterten, dem untätigen Zuschauer, der hätte eingereifen können, und dem sich beteiligenden Zuschauer, der nichts zu verhindern wünscht. Die perfide Logik des repressiven Staatsabgesandten, der in der Anwendung der Folter keinen Zivilisationsverlust erkennen kann, sondern einzig den Nutzen seiner »Arbeit« herausstellt.
Coetzee ist vollständig unaffektiert und transportiert im Erzählen das Ausmaß des Grauens immer auf einer psychologischen Ebene. Auf naturalistische Darstellungen (erinnern wir uns an die Bilder aus Abu-Ghuraib) wird verzichtet. Statt der Folter beschreibt Coetzee die Wunden – die sichtbaren körperlichen wie auch die psychischen. Dieser Verzicht aufs Voyeuristische hat mir besonders gefallen. Eine der intensivsten Passagen in dieser Erzählweise findet sich im letzten Kapitel (s. u.).
Dieses letzte Kapitel hätte ich um ein Haar gar nicht gelesen. Bedauerlicherweise ist die Dramaturgie gegen Ende ein wenig missglückt. Das vorletzte Kapitel markiert vom Spannungsbogen her eindeutig den Schluss. Auch fällt Coetzee mit dem letzten Kapitel aus dem Erzählfluss des vorangegangenen Textes. Es wirkt wie aus wunderbaren Bruchstücken zusammengesetzt, die der Autor nicht mehr zu einem organischen Ganzen zusammenfügen wollte oder konnte. Lesen muss man dieses letzte Kapitel dennoch unbedingt. Es spielt einige Zeit nach dem Abzug des Oberst Joll aus der Stadt, während die wenigen in der Stadt Zurückgeblieben auf die Barbaren warten …
Das Graben am dritten Brunnenloch ist eingestellt worden. Einige der Arbeiter sind schon heimgegangen, die anderen stehen herum und warten auf Anordnungen.
»Was ist das Problem?«, frage ich.
Sie zeigen auf die Knochen, die auf einem frischen Erdhaufen liegen — die Knochen eines Kindes.
»Hier muss ein Grab gewesen sein«, sage ich. »Ein seltsamer Ort für ein Grab.« Wir befinden uns auf dem unbebauten Gelände hinter der Kaserne, zwischen der Kaserne und der südlichen Mauer. Die Knochen sind alt, sie haben die Farbe des roten Lehms angenommen. »Was schlagen sie vor? Wir können dichter an der Mauer noch einmal zu graben anfangen, wenn Sie möchten.«
Sie helfen mir in die Grube hinein. Brusttief im Loch, kratze ich die Erde von einem Kieferknochen, der in der Seitenwand steckt. »Hier ist der Schädel«, sage ich. Doch nein, der Schädel ist schon ausgegraben worden, sie zeigen ihn mir.
»Schauen Sie mal nach, worauf Sie stehen«, sagt der Vorarbeiter.
Es ist so dunkel, dass man nichts sehen kann, aber als ich den Boden leicht mit der Hacke bearbeite, treffe ich auf etwas Hartes; meine Finger sagen mir, dass es Knochen sind.
»Die sind nicht ordentlich begraben«, sagt er. Er hockt am Grubenrand. »Sie liegen einfach so herum, übereinander.«
»Ja«, sage ich. »Hier können wir nicht graben, wie?«
»Nein«, sagt er.
»Wir müssen es zuschütten und dichter an der Mauer noch einmal anfangen.«
Er schweigt. Er streckt mir die Hand hin und hilft mir heraus. Die Herumstehenden sagen auch nichts. Ich muss die Knochen wieder hineinlegen und die erste Erde darauf werfen, ehe sie ihre Spaten wieder zur Hand nehmen.
Im Traum stehe ich wieder in der Grube. Die Erde ist feucht, dunkles Wasser quillt hoch, es quatscht unter meinen Füßen, nur mit Mühe kann ich sie heben.
Ich taste im Schlamm und suche nach Knochen. Meine Hand fördert den Zipfel eines Jutesacks zutage, schwarz, verfault, der mir zwischen den Fingern zerbröselt. Ich tauche die Hand wieder in den Schlick. Eine Mistgabel, verbogen und stumpf. Ein toter Vogel, ein Papagei: ich halte ihn beim Schwanz, seine schmutzigen Federn, seine durchweichten Flügel hängen schlaff herab, seine Augenhöhlen sind leer. Als ich ihn loslasse, fällt er ohne einen Spritzer ins angesammelte Wasser zurück. »Vergiftetes Wasser«, denke ich: »Hier darf ich auf keinen Fall trinken. Ich darf mit meiner rechten Hand den Mund nicht berühren.«
J. M. Coetzee
aus: »Warten auf die Barbaren«
© S. Fischer Verlag (2001)
Übersetzung: Reinhild Böhnke







Am 16. Januar 2009 um 15:25 Uhr
Auch ich habe über Waiting for the Barbarians was auf mein Blog geschrieben: